Am 26.
März 2005 wäre Viktor Frankl 100 Jahre alt geworden. Frankl,
Holocaust-Überlebender, weltbekannt als Wissenschaftler, Psychologe
und Neurologe war auch Zeit seines Lebens begeisterter Bergsteiger und
Kletterer. Sein Leben widmete er der Frage nach dem Sinn, dem Logos;
die Berge waren ihm in dieser Hinsicht ein Modell und richtungsweisende
Lehrmeister. Frankl eröffnete dem Bergsteigen neue geistige Dimensionen.
Am
27. April 1945 rollten amerikanische Panzer durch das bayerische KZ
Türkheim. Den Befreiern schleppen sich bis auf die Knochen abgemagerte,
kranke, schwache Gestalten entgegen, Menschen, die das Unfassbare überlebt
haben. Unter ihnen der 40 Jahre alte Viktor Frankl. Vier Konzentrationslager
hat er überlebt, unzählige Mitgefangene, darunter auch seinen
eigenen Vater, sterben sehen. Dem nicht genug, wird er zwischen den
Trümmern Wiens erfahren, dass auch seine Mutter, sein Bruder, seine
Frau und viele seiner Freunde der NS-Vernichtungsmaschinerie zum Opfer
gefallen sind. Frankl steht vor dem buchstäblichen Nichts, in der
Hand nur die Fragmente eines Buchmanuskripts mit dem Titel "Trotzdem
Ja zum Leben sagen".
Bergsteigen,
die Erinnerung, wie sich der Fels anfühlt, das war einer der Beweggründe,
die Schrecken des KZs zu überstehen.
 Schon
als Jugendlicher beginnt Frankl zu klettern: "Dem Klettern war
ich bereits 1924 verfallen und habe dann erst nach 60 Jahren - und da
war ich immerhin an die 80 - mit dem 3. Schwierigkeitsgrad aufgehört!".
Frankl tritt den Naturfreunden bei, dann, nachdem diese 1934 verboten
wurden, dem AV Donauland. Auch diese Sektion wird 1938 aufgelöst
und aus dem Alpenverein ausgeschlossen, weil sie es ablehnte, den Arierparagraphen
in ihre Statuten aufzunehmen. Frankl absolviert die Bergführerprüfung
und war so stolz darauf, dass er als eine der wenigen persönlichen
Habseligkeiten das Bergführer-Abzeichen vom KZ Theresianstadt bis
nach Auschwitz rettete. Dort allerdings muss er auch dieses mitsamt
seinem Ehering und seinem Buchmanuskript der SS ausliefern.
Schon
als Jugendlicher beginnt Frankl zu klettern: "Dem Klettern war
ich bereits 1924 verfallen und habe dann erst nach 60 Jahren - und da
war ich immerhin an die 80 - mit dem 3. Schwierigkeitsgrad aufgehört!".
Frankl tritt den Naturfreunden bei, dann, nachdem diese 1934 verboten
wurden, dem AV Donauland. Auch diese Sektion wird 1938 aufgelöst
und aus dem Alpenverein ausgeschlossen, weil sie es ablehnte, den Arierparagraphen
in ihre Statuten aufzunehmen. Frankl absolviert die Bergführerprüfung
und war so stolz darauf, dass er als eine der wenigen persönlichen
Habseligkeiten das Bergführer-Abzeichen vom KZ Theresianstadt bis
nach Auschwitz rettete. Dort allerdings muss er auch dieses mitsamt
seinem Ehering und seinem Buchmanuskript der SS ausliefern.
Die Hölle der KZs überlebt er mit kompromissloser Lebensbejahung
und der Gewissheit, dass das Leben – selbst unter widrigsten Umständen
- niemals an Sinn verliert. Aber auch die bloße Erinnerung an
die Berge tut das Ihre, Frankl mit Zuversicht zu stärken: "Bergsteigen,
die Erinnerung, wie sich der Fels anfühlt, das war einer der Beweggründe,
die Schrecken des KZs zu überstehen", so Viktor Frankl.
Als er zum ersten Mal nach der Gefangenschaft seine Hand an den Fels
legte, sei er glücklich gewesen wie selten zuvor.
Der
Berg – Lehrmeister des Lebens
Viktor
Frankl, der Sinnsucher und Seelenarzt schlechthin, war wohl der erste,
der plausible Beweggründe dafür benannte, weshalb ein Mensch
auf einen Berg stieg, um dann wieder herabzulaufen. Frankl kletterte
nicht auf den Berg, weil er "bloß da war" (George Mallory)
oder um das "Unnütze zu erobern" (Lionel Terray),
sondern weil er ihm als "Lehrmeister des Lebens" galt.
Frankl hat das zutiefst Menschliche, Sinnhafte und Sinngebende des Bergsteigens
in Worte gefasst und auf den allgemeinen Lebenszweck zu übertragen.
Mehr noch: Seine Gedanken übers Bergsteigen verband er immer auch
mit der Frage nach einem geglückten Leben. So wird die Tatsache,
dass das Erreichen eines definierten Ziels wie ein Gipfel Glücksgefühle
induziert, zum Fundament seiner Logotherapie: Nimm dir ein Ziel vor,
gehe darauf zu, erreiche es und du wirst ein anderer Mensch. Frankl,
der sich mit dem Sinn des Lebens gerade in schwierigen, ja scheinbar
aussichtslosen Situationen beschäftigte, sprach in seinen Büchern
immer wieder von der großen Bedeutung der Herausforderung. Jemand,
der eine Herausforderung annimmt, geht seinen Lebensweg anders, als
einer, der ziellos vor sich hin lebt. Der Blick auf den Gipfel, die
Vision eines sichtbaren Zieles macht Mut, gibt die Richtung vor, setzt
Energien frei, eröffnet Sinn – all das verglich er immer wieder
mit einem Kletterer, der gerade dann besonders motiviert ist, wenn er
in einer Wand eine unerwartet schwierige Steig-Variante findet. Wie
er selbst auf dem "Drei-Enzian-Steig" (Rax, Schwierigkeitsgrad
II-III), seiner Lieblingsroute, die er gleichsam zur "Selbsttherapie"
mehrmals jährlich beging.
Eine
weitere Voraussetzung für ein sinnerfülltes Leben war für
Frankl neben einem definierten Ziel die Überwindung der Angst.
Muss
man sich denn auch alles von sich gefallen lassen? Kann man nicht stärker
sein als die Angst?
Die
Trotzmacht des Geistes gegen die Angst
 Auf
die Frage, wie er selbst zum Klettern gekommen sei, antwortete Frankl:
"Offen gesagt, die Angst davor." Diese Angst vor der
Höhe, dem Abgrund, dem falschen Griff wirkte für den bekannten
Neurologen und Psychiater geradezu als Würze des Lebens: "Muss
man sich denn auch alles von sich gefallen lassen? Kann man nicht stärker
sein als die Angst? Und so habe ich denn auch mich, als ich mich vor
dem Klettern fürchtete, gefragt: Wer ist stärker, ich oder
der Schweinehund in mir? Ich kann ihm ja auch trotzen. Es gibt doch
etwas im Menschen ... die Trotzmacht des Geistes gegenüber Ängsten
und Schwächen der Seele." Diese "Trotzmacht des
Geistes" war für den Professor und geprüften Bergführer
die wichtigste Voraussetzung beim Bergsteigen: Der Geist müsse
den Ängsten und Schwächen der eigenen Seele widerstehen, damit
der Mensch an die Grenzen des ihm Möglichen gelangen könne.
In der Kletterei, im gefahrvollen Balancieren über dem Abgrund,
zwischen Sein und Nichtsein wiederum sah er eine heilsame Übung,
die "Trotzmacht des Geistes" zu stärken, um auch
gegen die Alltagsängste gewappnet zu sein. Der Umgang mit der Angst
lässt sich modellhaft also durchaus am Felsen üben. Dementsprechend
gibt es beim Klettern für Frankl nicht die Rivalität mit einem
anderen Konkurrenten, sondern nur die Rivalität mit sich selbst.
"Der Alpinist konkurriert und rivalisiert nur mit einem, und
das ist er selbst. Er verlangt etwas von sich, er fordert etwas von
sich, eine Leistung - womöglich -, aber auch eine Verzicht-Leistung
- wenn nötig, einem krankmachenden und einem gesund erhaltenden
Stress, und er steht nicht an, den letzteren geradezu als "the
salt of life", das Salz des Lebens, und ein andermal als "the
spice of life", die Würze des Lebens, zu bezeichnen."
Frankl erteilt also dem Wettkampf, dem Höher, Schneller, Gewagter
etc. eine klare Absage. Der Kletterer sollte es nicht mit anderen aufnehmen,
sondern einzig mit sich selbst.
Auf
die Frage, wie er selbst zum Klettern gekommen sei, antwortete Frankl:
"Offen gesagt, die Angst davor." Diese Angst vor der
Höhe, dem Abgrund, dem falschen Griff wirkte für den bekannten
Neurologen und Psychiater geradezu als Würze des Lebens: "Muss
man sich denn auch alles von sich gefallen lassen? Kann man nicht stärker
sein als die Angst? Und so habe ich denn auch mich, als ich mich vor
dem Klettern fürchtete, gefragt: Wer ist stärker, ich oder
der Schweinehund in mir? Ich kann ihm ja auch trotzen. Es gibt doch
etwas im Menschen ... die Trotzmacht des Geistes gegenüber Ängsten
und Schwächen der Seele." Diese "Trotzmacht des
Geistes" war für den Professor und geprüften Bergführer
die wichtigste Voraussetzung beim Bergsteigen: Der Geist müsse
den Ängsten und Schwächen der eigenen Seele widerstehen, damit
der Mensch an die Grenzen des ihm Möglichen gelangen könne.
In der Kletterei, im gefahrvollen Balancieren über dem Abgrund,
zwischen Sein und Nichtsein wiederum sah er eine heilsame Übung,
die "Trotzmacht des Geistes" zu stärken, um auch
gegen die Alltagsängste gewappnet zu sein. Der Umgang mit der Angst
lässt sich modellhaft also durchaus am Felsen üben. Dementsprechend
gibt es beim Klettern für Frankl nicht die Rivalität mit einem
anderen Konkurrenten, sondern nur die Rivalität mit sich selbst.
"Der Alpinist konkurriert und rivalisiert nur mit einem, und
das ist er selbst. Er verlangt etwas von sich, er fordert etwas von
sich, eine Leistung - womöglich -, aber auch eine Verzicht-Leistung
- wenn nötig, einem krankmachenden und einem gesund erhaltenden
Stress, und er steht nicht an, den letzteren geradezu als "the
salt of life", das Salz des Lebens, und ein andermal als "the
spice of life", die Würze des Lebens, zu bezeichnen."
Frankl erteilt also dem Wettkampf, dem Höher, Schneller, Gewagter
etc. eine klare Absage. Der Kletterer sollte es nicht mit anderen aufnehmen,
sondern einzig mit sich selbst.
Der
Alpinist konkurriert und rivalisiert nur mit einem, und das ist er selbst.
Frankls
Botschaft auf das Alltagsleben übertragen: Setze der Angst die
Trotzmacht des Geistes entgegen, bejahe das Leben, egal, woran du leidest
und wovor du Angst hast. Seine Therapie am Sinn macht dem Patienten
klar: Du selbst hast alles in dir, um dein Leben sinnvoll zu und schön
zu gestalten. Wenn nichts mehr änderbar ist – dein Selbst
ist noch änderbar.
Selbst die Angst vor dem Tod war für Frankl nie ein Thema: Auf
die Frage, wie er damit umgehe, antwortet er: "Wer im Großen
und Ganzen das Seine getan hat, fürchtet den Tod nicht. Nur wer
falsch gelebt hat, sieht im Tod irrtümlich die gerechte Strafe,
der man nicht entgehen kann. Man soll so leben, dass man auf Erden mit
dem Tod gut Freund wird."
Frankl lernt seine Höhenangst auf nicht leichten Routen zu bezwingen
und erwirbt noch mit 70 Jahren den Flugschein.
Die
Rax hat auf mich persönlich immer schon eine Faszination ausgeübt,
"Lebensberg"
Rax
Frankl
war ein Mensch, der vor allem aus dem Geist heraus lebte, aber auch
kräftig zupacken konnte. Entsprechend seiner Liebe für die
Höhen des Geistes war er erfüllt von der Liebe zu den Höhen
der Berge und Felsen. Auf der Rax bei Wien, speziell auf der klettertechnisch
anspruchsvollen Preiner Wand, fand er jenes Modell, an dem seine Tätigkeit
als Therapeut, aber auch sein Verständnis als Mensch austesten,
verinnerlichen konnte.
 Die
Rax war ihm in erster Linie ein Refugium, ein meditativer Fluchtpunkt,
ja, sein "Lebensberg", wie er seine Rax einmal genannt
hat: "Die Rax hat auf mich persönlich immer schon eine
Faszination ausgeübt, es ist so, wenn ich auf die Rax komme und
wenn ich übers Plateau gehe, dass dies die einzige Zeit in meinem
Leben ist, in der ich immer wieder, ich möchte sagen, meditiert
habe." Der Berg bietet ihm, dem Stadtmenschen, einen Denkraum,
eine Inspirationsstube, aus der er seine Kraft, seine Ideen und seinen
unbändigen Lebenswillen schöpfen konnte: "In den Bergen
bekommen die Gedanken ihren freien Lauf, und es gibt eigentlich keine
größere, wesentliche Entscheidung in meinem Leben, beruflicher
und privater Natur, die ich nicht dort getroffen hätte. Und so
wandere ich übers Plateau im Sinn der vita contemplativa, also
des Meditierens, des beschaulichen Lebens", bekennt Viktor
Frankl. Vor allen wichtigen Entscheidungen bricht er vom Knappenhof
in Edlach, seinem ganz persönlichen "Basislager", auf
die Rax auf, um ebendort auch die meisten Einfälle seiner zahlreichen
Publikationen entstehen zu lassen. So gesehen war er ein Vorläufer
jener heutigen Genusswanderer und Nordic-Walker, die nicht mehr auf
die Berge gehen, um sich mit anderen in Bestzeiten zu duellieren, sondern
um zu sich selbst zu kommen.
Die
Rax war ihm in erster Linie ein Refugium, ein meditativer Fluchtpunkt,
ja, sein "Lebensberg", wie er seine Rax einmal genannt
hat: "Die Rax hat auf mich persönlich immer schon eine
Faszination ausgeübt, es ist so, wenn ich auf die Rax komme und
wenn ich übers Plateau gehe, dass dies die einzige Zeit in meinem
Leben ist, in der ich immer wieder, ich möchte sagen, meditiert
habe." Der Berg bietet ihm, dem Stadtmenschen, einen Denkraum,
eine Inspirationsstube, aus der er seine Kraft, seine Ideen und seinen
unbändigen Lebenswillen schöpfen konnte: "In den Bergen
bekommen die Gedanken ihren freien Lauf, und es gibt eigentlich keine
größere, wesentliche Entscheidung in meinem Leben, beruflicher
und privater Natur, die ich nicht dort getroffen hätte. Und so
wandere ich übers Plateau im Sinn der vita contemplativa, also
des Meditierens, des beschaulichen Lebens", bekennt Viktor
Frankl. Vor allen wichtigen Entscheidungen bricht er vom Knappenhof
in Edlach, seinem ganz persönlichen "Basislager", auf
die Rax auf, um ebendort auch die meisten Einfälle seiner zahlreichen
Publikationen entstehen zu lassen. So gesehen war er ein Vorläufer
jener heutigen Genusswanderer und Nordic-Walker, die nicht mehr auf
die Berge gehen, um sich mit anderen in Bestzeiten zu duellieren, sondern
um zu sich selbst zu kommen.
In
den Bergen bekommen die Gedanken ihren freien Lauf.
Frankl
war aber nicht nur ein nach innen gerichteter, kontemplativer Geistmensch,
sondern auch ein aktiver, zupackender Tatmensch. Seine typische Art
als Therapeut war es, nicht lange zu "fackeln", sondern tätig
einzugreifen, mutig auf die Herausforderung, den  Patienten,
zuzugehen und die Befindlichkeiten seines Gegenübers blitzschnell
zu erg r e i f e n. All diese Eigenschaften übt er als Kletterer
im Fels der Preiner Wand: "Wenn ich bei der Preiner Wand angekommen
bin, beginnt die vita aktiva, das tätige Leben, das zugreifende,
das anpackende – buchstäblich den Fels 'anpackende' –
Leben."
Patienten,
zuzugehen und die Befindlichkeiten seines Gegenübers blitzschnell
zu erg r e i f e n. All diese Eigenschaften übt er als Kletterer
im Fels der Preiner Wand: "Wenn ich bei der Preiner Wand angekommen
bin, beginnt die vita aktiva, das tätige Leben, das zugreifende,
das anpackende – buchstäblich den Fels 'anpackende' –
Leben."
Folgende Begebenheit unterstreicht, in welcher Weise Frankl den Fels
"angepackt" hat: Als er einmal am Seil eines Bergführers
und Extrembergsteigers die Preiner Wand durchkletterte, sagte jener
zu ihm: "Sind Sie mir nicht böse, Herr Professor, wenn
ich Ihnen so zuschaue, Sie haben überhaupt keine Kraft mehr. Aber
wissen Sie, wie Sie das wettmachen durch raffinierte Klettertechnik,
ich muss schon sagen, von Ihnen kann man klettern lernen."
Tatsächlich kletterte Frankl sehr ruhig und bedacht. Hatte er einmal
einen Griff gefasst, blieb er dabei und ließ ihn nicht mehr los.
Mit der Zeit entwickelte sich der Harvard-Professor zum guten Kletterer,
der auch schwierige Touren wie die Dachstein-Südwand oder das Totenkirchl
im Wilden Kaiser bewältigte. Zu seinen Kletterpartnern zählten
u.a. der Nacherschließer der Raxwände, Rudolf Reif, aber
auch Peter Aschenbrenner und Manfred Innerkofler, mit dem er die Große
Zinne und den Luis Trenker-Kamin am 2. Sella-Turm durchstieg.
Nicht umsonst wurden zwei Steige in den Wiener Hausbergen nach Frankl
benannt – einer im Bereich der Vormäuer der Rax, der andere,
die "Prof. Viktor Frankl-Kante", am Peilstein im Bereich
der Luckerten Wand.
Genau
darin sehe ich die Funktion, um nicht zu sagen die Mission, des Sports
im allgemeinen und des Alpinismus im besonderen: sie sind die moderne,
die säkulare Form der Askese.
Berge
- säkulare Inseln der Askese
In
einem Vortrag (1988) anlässlich der Feier "125 Jahre Österreichischer
Alpenverein" setzt er dem "Sinnlosigkeitsgefühl"
und der auf "totale Bedürfnisbefriedigung abgestellten
Konsumgesellschaft" so genannte "Inseln der Askese"
entgegen: "Weltweit
leiden die Menschen, insbesondere junge Menschen, unter einem Sinnlosigkeitsgefühl.
Sie besitzen die Lebens-Mittel, die Mittel zum Leben; aber sie entbehren
einen Lebens-Zweck, auf den hin zu leben, weiterzuleben, es sich auch
dafürstünde."
Ohne
die Ausrichtung auf Ideale könne der Mensch aber nicht überleben.
Für Ideale müsse man kämpfen, warten können, es
bedürfe dafür der sogenannten "Frustrationstoleranz",
die es zu trainieren gelte. Vor allem junge Menschen seien unfähig,
"Frustrationen
wegzustecken; sie sind unfähig, auf die Erfüllung ihrer Wünsche
zu warten; sie sind unfähig, auf etwas, das sie noch nicht haben,
zu verzichten oder gar etwas, das sie bereits besitzen, zu opfern. In
ihrer Frustrations-Intoleranz sind diese jungen Menschen nicht mehr
fähig, abwendbares Leid abzuwenden und unabwendbares Leid auszuhalten",
so
Viktor Frankl. Eine mögliche Lösung:
"Der biologisch unterforderte Mensch arrangiert sich nun freiwillig,
künstlich und absichtlich Notwendigkeiten höherer Art, indem
er aus freien Stücken von sich etwas fordert, sich etwas versagt,
auf etwas verzichtet. Inmitten des Wohlstands sorgt er für Situationen
des Notstands; mitten in einer Überflussgesellschaft beginnt er,
sozusagen Inseln der Askese aufzuschütten - und genau darin sehe
ich die Funktion, um nicht zu sagen die Mission, des Sports im allgemeinen
und des Alpinismus im besonderen: sie sind die moderne, die säkulare
Form der Askese."
Indem
der Kletterer seine Grenze immer wieder hinausschiebt - wächst
er auch über sich selbst hinaus ...
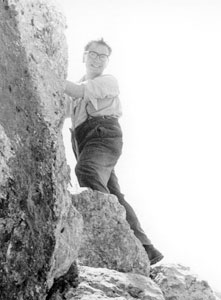 Frankls
säkulare "Inseln der Askese", wie sie z.B. in
den Bergen zu finden sind, sollen die Spannung zwischen Stadtzivilisation
und Natur, zwischen dauerndem Überfluss und seltenem Mangel überbrücken
helfen. Frankl trifft hier genau den Nerv der Zeit und gibt die heute
so bestimmende Richtung zum naturnahen, enthobenen, einfachen Leben
vor.
Frankls
säkulare "Inseln der Askese", wie sie z.B. in
den Bergen zu finden sind, sollen die Spannung zwischen Stadtzivilisation
und Natur, zwischen dauerndem Überfluss und seltenem Mangel überbrücken
helfen. Frankl trifft hier genau den Nerv der Zeit und gibt die heute
so bestimmende Richtung zum naturnahen, enthobenen, einfachen Leben
vor.
Ein Leben aber nicht ohne Herausforderung: Am Beispiel des Kletterns
demonstriert Frankl eine mögliche Lebensform: "Im Gegensatz
zum, biologisch gesehen, im Schongang lebenden Menschen wählt der
Kletterer im Gebirge nicht "den Weg des geringsten Widerstands",
sondern zieht es vor, auf einer Klettertour sich die schwierigste Route
auszusuchen, der er gerade noch gewachsen ist." Dem Kletterbegeisterten
gehe es um die "Grenze des Menschenmöglichen"
und darum, diese Grenze auszukundschaften. "Und siehe da: es
ergeht ihm dabei so wie mit dem Horizont; denn mit jedem Schritt, den
er auf ihn zugeht, weicht der Horizont vor ihm zurück; in dem Maße,
in dem er sich ihm nähert, schiebt er ihn auch schon vor sich her;
er schiebt ihn immer mehr hinaus - ganz genau so, wie er, etwa in der
Geschichte des "extremen" und "freien" Kletterns,
die Grenze des Menschenmöglichen hinausgeschoben hat. Indem er
diese Grenze aber immer wieder hinausschiebt - wächst er auch über
sich selbst hinaus ..."
Heilung und
Sinnfindung durch Herausforderung, Angstfreiheit durch Bewusstseinsschärfung,
kontemplative Geisträume und Inseln der Askese an den Gefielden der
Berge – zum Lebenssinn könnte man laut Viktor Frankl durchaus
klettern. 
